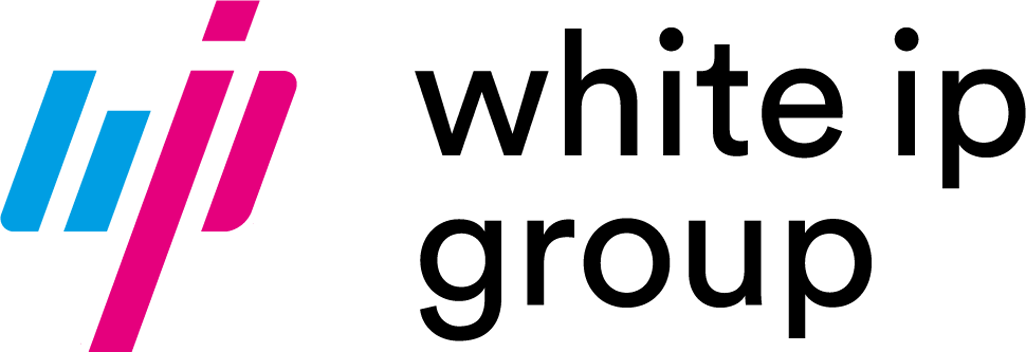Arbeitszeitkonten
Formen, Anrechnung, rechtliche Vereinbarungen: die Anwälte für Arbeitsrecht der Dresdner Kanzlei white ip | Patent & Legal beantworten Ihre Fragen zu Arbeitszeitkonten.
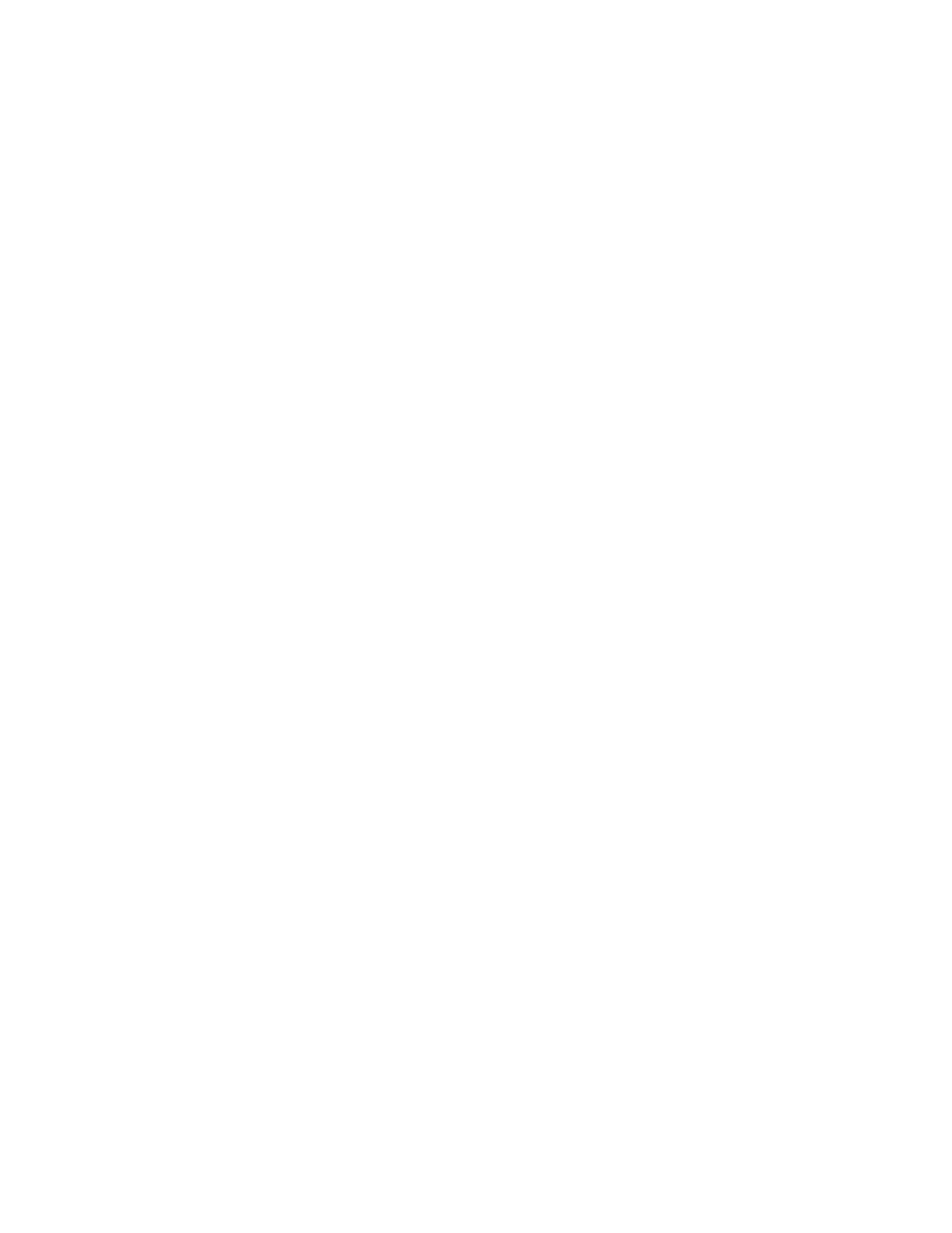
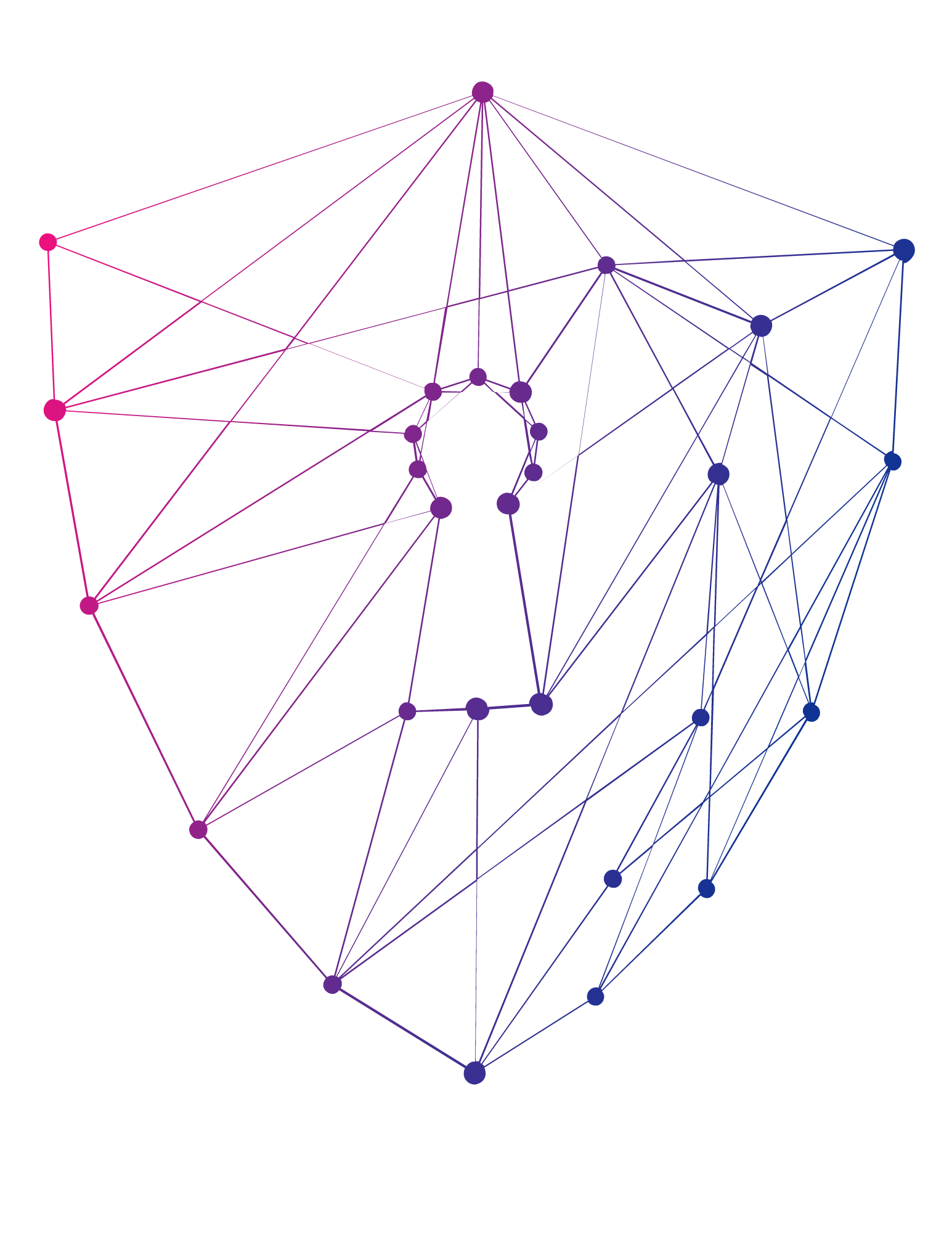
Die Anwälte der white ip | Patent & Legal haben langjährige Erfahrungen im Bereich der Arbeitszeiterfassung und Arbeitsvertragserstellung und beraten Sie jederzeit umfassend und kompetent dazu, ob eine Arbeitszeitkontenvereinbarung für Ihr Unternehmen Sinn ergibt und welche Form der Kontenvereinbarung für Ihr Unternehmen am effektivsten ist.
Unser Team ist für Sie per Telefon unter 0351 ·896 921 40 oder unter der E-Mail-Adresse recht@white-ip.com für Sie erreichbar.
Wir stehen für Beratungen in Dresden, Leipzig, Berlin, Köln, München, Hamburg und darüber hinaus zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Anliegen und dem Wunsch nach einer Online- oder Vor-Ort-Beratung!
Wir finden gemeinsam einen Termin.
Oft gestellte Fragen zu Arbeitszeitkonten
Was ist ein Arbeitszeitkonto?
Der Standardsatz zur Erklärung, worum es sich bei einem Arbeitszeitkonto handelt, lautet, dass bei einem solchen auf schriftliche oder elektronische Weise die tatsächlich geleistete Arbeit, inklusive Urlaub, Krankheit, Überstunden und so weiter, des Mitarbeiters festgehalten und mit der arbeitsvertraglich oder tarifvertraglich zu leistenden Arbeitszeit verrechnet wird.
Arbeitet ein Mitarbeiter mehr als arbeits- oder tarifvertraglich vereinbart, schreibt er „Plusstunden“, arbeitet er weniger, so schreibt er „Minusstunden“.
Nach einem vertraglich vereinbarten Zeitraum, meist monats- oder jahresweise, findet dann eine Verrechnung dieser beiden Ergebnisse und ein entsprechender Ausgleich statt.
Derartige vertragliche Arbeitszeitregelungen sind kompliziert, weil klar sein muss, wann Plus- und wann Minusstunden anfallen, wie viele Plus- und wie viele Minusstunden Arbeitnehmer anhäufen können und was bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit den Stundenguthaben bzw. den Minusstunden geschehen soll.
Welche Arten von Arbeitszeitkonten gibt es?
Arbeitszeitkonten werden im Wesentlichen anhand des zeitlich vereinbarten Ausgleichrahmens unterschieden. Dabei differenziert man grundsätzlich zwischen Kurzzeitkonten und Langzeitkonten, welche dann wiederum in verschiedene Unterkategorien unterteilt werden.
Kurzzeitkonten
Mit dem Begriff Kurzzeitkonten bezeichnet man solche Arbeitszeitkonten, deren Ausgleichszeitraum nicht über ein Jahr beträgt.
Gleitzeit
Die sogenannte Gleitzeit ist als „Urform“ des Arbeitszeitkontos die am meisten verbreitete Form der Kontoführung. Bei einer einfachen Gleitzeitvereinbarung hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit im Rahmen bestimmter Grenzen frei zu wählen, beispielsweise 8 Stunden Arbeit in einem Rahmen von 06:00 – 22:00 Uhr. Möglich ist auch die Festlegung einer „Kernarbeitszeit“ innerhalb derer Arbeitsstunden geleistet werden müssen, während der Rest frei gewählt werden darf, beispielsweise Kernarbeitszeit zwischen 10:00 – 14:00 während die übrigen 4 Stunden innerhalb des Rahmens von 06:00 – 22:00 Uhr geleistet werden können.
Bei einer qualifizierten Gleitzeit kann der Arbeitnehmer nicht nur über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, sondern auch über die Dauer selbst entscheiden. Festgelegt ist lediglich eine wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit, welche der Arbeitnehmer zu erreichen hat. Erreicht er diese nicht, werden ihm Minusstunden angerechnet.
Jahresarbeitszeitkonto
Beim Jahresarbeitszeitkonto ist der Ausgleichszeitraum entsprechend dem Namen das jeweilige Jahr. Eine solche Vereinbarung führt zu einem hohen Maß an Flexibilität für die Verteilung der Arbeitszeit. Idealerweise weist das Konto dabei zum, oder kurz vor Ende des Ausgleichszeitraums einen Betrag von +/- Null aus. Allerdings besteht bei dieser Kontenvereinbarung die Gefahr das eine hohe Anzahl an Ausgleichspflichtigen Plus- oder Minusstunden aufläuft.
Ampelkonto
Das sogenannte Ampelkonto stellt grundsätzlich keine eigene Arbeitszeitkontenform dar, sondern erweitert nur die bereits erläuterten Varianten. Es zeichnet sich durch die Einführung eines Warnsystems aus. Hierbei wird der Stundensaldo des Arbeitnehmers regelmäßig kontrolliert und festgestellt, ob das Konto zu viele, oder zu wenige Stunden ausweist.
Es werden drei verschiedene Phasen unterschieden:
- Grünphase (beispielsweise bis +/- 30 Stunden) – die Mitarbeiter tragen die Verantwortung über die Arbeitszeit allein.
- Gelbphase (beispielsweise bis +/- 40 Stunden) – erfordert das Zusammenwirken von Mitarbeitern und Vorgesetzten, um wieder in die Grünphase zurückzukehren.
- Rotphase (beispielsweise bis +/- 60 Stunden) – die Vorgesetzten sorgen dafür, dass die Arbeitszeitsalden der Mitarbeiter wieder in den gelben und grünen Bereich zurückgeführt werden.
Durch eine konsequente Beobachtung und Regulierung von Arbeitszeitkonten kann sichergestellt werden, dass sich keine Zeitguthaben ansammeln, die durch Freizeitausgleich quasi nicht mehr abgebaut werden können. Somit wird eine finanzielle Überbelastung des Betriebs durch mehrere hohe, meist gleichzeitig fällige, Ausgleichszahlungen verhindert. Die Stundenvorgaben, wann die Gelb- und die Rotphase einsetzt, sind in den Unternehmen je nach Bedarf unterschiedlich hoch.
Arbeitszeitkorridor
Die Regelung des sogenannten Arbeitszeitkorridors gibt dem Arbeitgeber die Befugnis über Lage und Dauer der täglichen Arbeitszeit zu verfügen. Im Rahmen einer solchen Regelung ist der Arbeitgeber, nach entsprechender vorab erfolgender Ankündigung befugt, die vertraglich festgelegte Arbeitszeit innerhalb bestimmter Ober- und Untergrenzen in Abhängigkeit vom Arbeitsaufkommen zu bestimmen. So kann die wöchentliche Arbeitszeit bei einer vertraglichen Durchschnittsarbeitszeit von 35 Stunden in der Woche vom Arbeitgeber frei zwischen 30 und 40 Stunden gewählt werden. Der Arbeitgeber muss lediglich sicherstellen, dass der Arbeitnehmer im gewählten Ausgleichszeitraum auf seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit kommt, denn für die Erreichung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ist grundsätzlich der Arbeitgeber im Rahmen seiner Einteilungs- und Direktionsbefugnis verpflichtet. Sollte er daher einen Arbeitnehmer nicht bis zur Höhe seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit einteilen, kommt auch keine Anrechnung von Minusstunden in Betracht.
Langzeitkonten
Langzeitkonten dienen wie sich dem Namen bereits entnehmen lässt, dem langfristigen Ansparen von Arbeitszeitguthaben. Mithilfe solcher Konten ist es möglich Arbeitsstunden (Plusstunden) auf einem separaten Arbeitszeitkonto anzusparen.
Langzeitarbeitskonten werden fast ausschließlich als sogenannte Lebensarbeitszeitkonten geführt mit dem Ziel in den vorzeitigen Ruhestand gehen zu können. Hierzu wird „überschüssige“ Arbeitszeit auf dem Konto gutgeschrieben und angespart. Diese überschüssige Arbeitszeit ergibt sich aus der Vereinbarung eines zusätzlichen Stundenkontingents. So wird vom Arbeitnehmer beispielsweise statt einer 40-Stundenwoche regelmäßig eine 42,5 Stundenwoche geleistet. Möglich ist aber auch eine Einbringung von Überstunden, nicht genommenem Urlaub, Einmalzahlungen und sonstigen Arbeitgeberleistungen. Seit 2009 ist ein Einbringen von „Stunden“ auf einem Langzeitkonto nicht mehr gestattet, daher sind diese jeweils in Geld umzurechnen. Aufgrund dieser zwingend vorzunehmenden Umrechnung kann allerdings auch vereinbart werden, dass das Arbeitszeitkonto als Kapital-/Wertanlage genutzt werden soll. So ist nach § 7d SGB IV eine Anlage in Aktien oder Aktienfonds bis zu einer Höhe von 20 % zulässig.
Grundsätzlich sind auch andere Verwendungsmöglichkeiten eines Langzeitkontos möglich, wie beispielsweise die Verwendung zu einem zeitweiligen Ausstieg aus dem Berufsleben; sog. „Sabbatical“, aber auch bei Vereinbarung von Teil-, Eltern- oder Pflegezeit unter Weiterzahlung der vollen Bezüge (bis das Konto aufgebraucht ist).
Auswirkungen nach Kündigung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Aufpassen muss der Arbeitnehmer, wenn das Konto bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses an ihn ausgezahlt wird. Die Höhe des ALG-I mindert sich grundsätzlich nicht, da bei der Bemessung der Höhe des Arbeitslosengeldes das Arbeitsentgelt zugrunde gelegt wird, welches ohne die Arbeitszeitkontenvereinbarung erzielt worden wäre.
Auf Zahlungen des Bürgergelds wird die Auszahlung allerdings angerechnet. Um dieser Konsequenz vorzubeugen, kann das Guthaben auf dem Lebensarbeitszeitkonto bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch, anstatt ausgezahlt zu werden, auch auf die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) umgestellt werden.
Unsere Dresdner Rechtsanwälte der white ip | patent & legal beraten Sie zu diesen Problematiken jederzeit umfassend und professionell. Gemeinsam finden wir eine individuelle, passende Lösung.
Was müssen Arbeitgeber bei einer Arbeitszeitkontenvereinbarung beachten?
Im Streitfall gilt, dass die jeweiligen auf dem Arbeitszeitkonto festgeschriebenen Stundenanzahlen nachvollziehbar sein müssen. Daher hat der Arbeitgeber im Regelfall zumindest darzulegen, wie und warum die im Arbeitszeitkonto aufgeführten Minusstunden entstanden sind (beispielsweise Krankheit oder Urlaub). Viele Arbeitszeitkonten beachten diese im Streitfall wichtige Frage nicht. Es fehlt oftmals jedweder Hinweis auf den Entstehungsgrund. Da zumeist auch keine Gegenzeichnungspflichten vereinbart werden führt dies in einem Gerichtsverfahren zu erheblichen Problemen für den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, je nachdem ob die Minus- oder die Plusstunden auf dem Arbeitszeitkonto überwiegen.
Arbeitsvertragliche Klauseln sind seit dem Jahr 2002, aufgrund eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts, wie AGB einer Inhaltskontrolle im Sinne der §§ 305 ff. BGB zu unterziehen. Dies führt aufgrund der Interessenabwägung nach § 307 Abs. 1 BGB häufig zur Unwirksamkeit der Regelung zur Arbeitszeitkontenregelung.
Wie bereits ausgeführt ist die vertragliche Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos durchaus kompliziert und an die jeweiligen Bedürfnisse im Betrieb anzupassen. Dennoch kommt es überraschend oft vor, dass Arbeitsverträge vorformulierte Standardklauseln enthalten, welche so vermutlich direkt aus dem Internet übernommen wurden und bereits an sich nur ein Muster darstellen, welches darüber hinaus den betrieblichen Besonderheiten keinerlei Beachtung schenken (können). Deshalb fehlen in solchen Fällen oft essenzielle Regelungen, wie beispielsweise eine Regelung bezüglich einer Gutschrift, soweit der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung ohne Arbeitsleistung hat. Oft fehlt es auch an einer Bestimmung zur Abrechnung und Übertragung von Mehrarbeits- und Minusstunden am Ende des Ausgleichszeitraums. Nicht selten fehlen Regelungen zur Führung des Arbeitszeitkontos gänzlich.
Als Mindestanforderung sollte eine wirksame Arbeitszeitkontenvereinbarung Antworten zu folgenden Fragen beinhalten:
- Welchen Prüfpflichten hat der Arbeitgeber in Bezug auf das Konto nachzukommen?
- Besteht ein mögliches Einsichtsnahmerecht durch den Arbeitnehmer, um den Anforderungen an das Transparenzgebot zu entsprechen?
- Besteht eine Gegenzeichnungspflicht?
- Wie hoch ist die maximale Bandbreite des Arbeitszeitkontos?
Sollte Ihre Arbeitszeitkontenregelung eine dieser Fragen nicht beantworten können, spricht viel für eine Nichtigkeit der Vereinbarung. Aufgrund des sogenannten Verbots der Geltungserhaltenden Reduktion ist die Vereinbarung regelmäßig auch nicht im Übrigen wirksam, sondern im Ganzen nichtig.
Sollten Sie als Arbeitgeber feststellen, dass die Regelung in Ihren Arbeitsverträgen den dargestellten Anforderungen nicht entspricht, empfehlen wir umgehend einen Rechtsanwalt aufzusuchen, um eine wirksame Regelung zu erstellen. Die Rechtsanwaltskanzlei white ip | Patent & Legal in Dresden verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der Erstellung von Arbeitszeitkontenvereinbarung und Arbeitsverträgen. Um für Ihr Unternehmen die bestmögliche Regelung zu wählen, legen wir ein besonderes Augenmerk auf eine enge Abstimmung mit dem Arbeitgeber .
Ansprechpartner

Albrecht Lauf
white ip | Patent & Legal
Königstraße 7 | 01097 Dresden
white ip | Patent & Legal
URTEILE
Farbmarken – ein leuchtendes Beispiel für Markenidentität
Farben spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer unverwechselbaren Identität für Produkte und Dienstleistungen.
Halloumi – Der Käse, der auch rechtlich quietscht
Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilt über geschützte Ursprungsbezeichnung: Darf nur echter zyprischer Halloumi als Halloumi bezeichnet werden?
Strategien einer Designanmeldung – Grundlagen des Designschutzes
Wie umfassend oder detailreich sollte eine Design-Anmeldung ausgestaltet sein, um tatsächlich effektiv gegen Nachahmer abgesichert zu sein?
Wir unterstützen Sie im:
Unser Netzwerk bringt Ihre Idee auf die große Bühne und macht Sie zum Publikumsliebling.